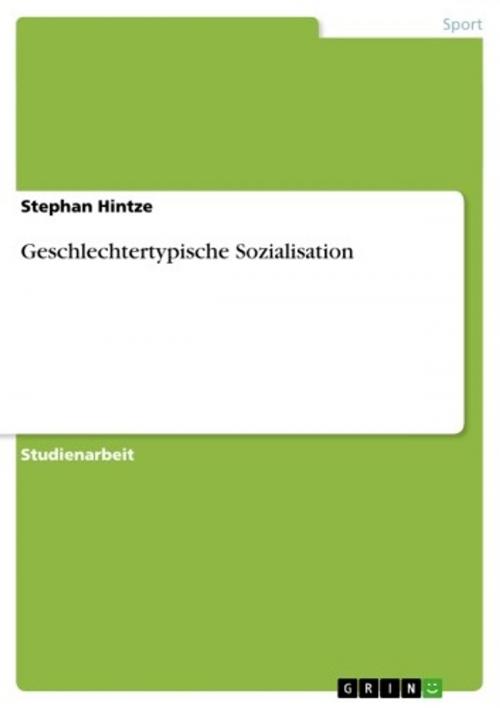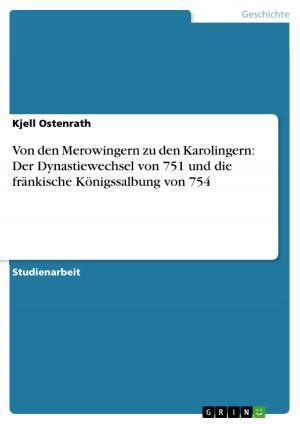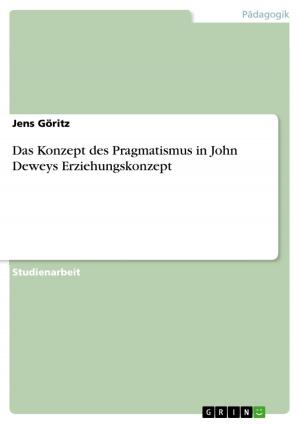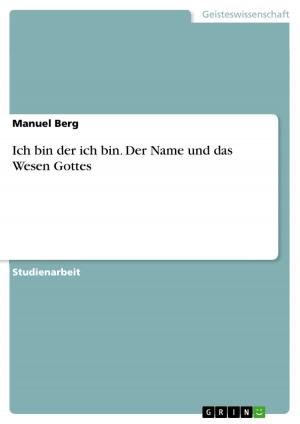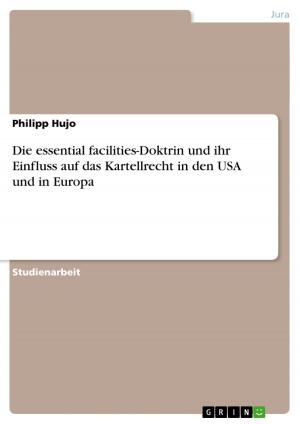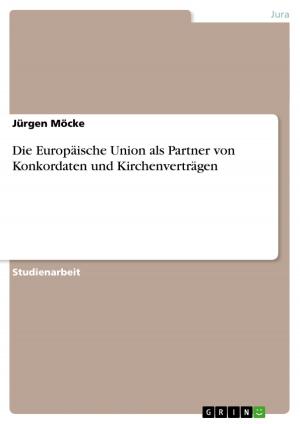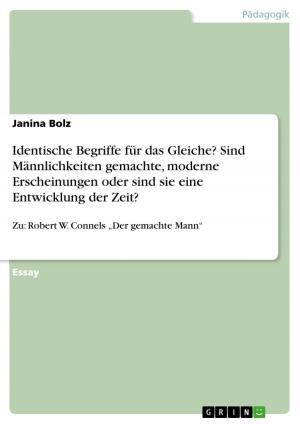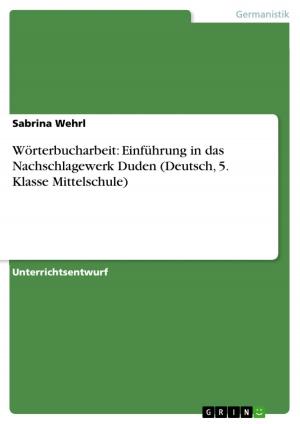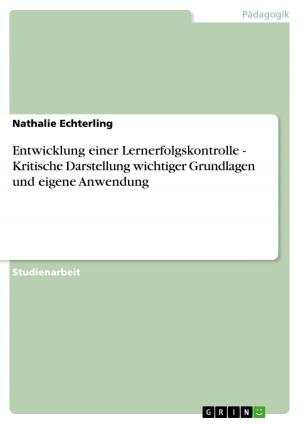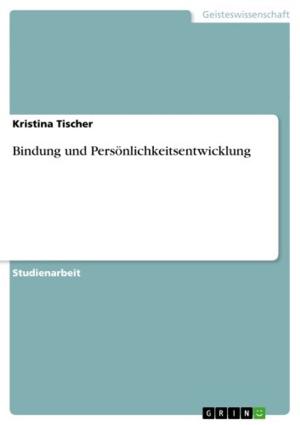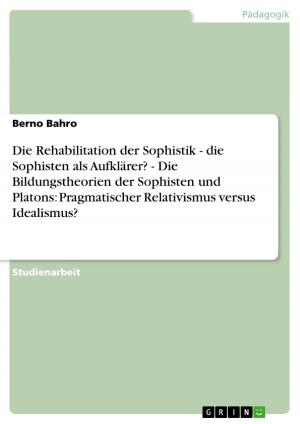| Author: | Stephan Hintze | ISBN: | 9783638244596 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | January 12, 2004 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Stephan Hintze |
| ISBN: | 9783638244596 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | January 12, 2004 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Sport - Sportsoziologie, Note: gut, Universität Potsdam (Sportwissenschaft), Veranstaltung: Seminar Sportsoziologie: Sportengagment von Heranwachsenden, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. geschlechtsspezifische Sozialisation 1.1 Vorbemerkungen Die Individuelle Entwicklung von Kindern wird in einem sehr hohen Maße durch die Zugehörigkeit zu einer Geschlechterkategorie bestimmt. Diese individuelle Entwicklung erfolgt nicht nur aufgrund von biologischen Unterschieden, sondern auch in sehr stark durch die sozialen Zuschreibungsmuster wie Rollenerwartungen und Stereotypen. Das bildet auch die Grundlage der sich dafür, das sich Sportkarrieren von Frauen und Männern unterscheiden. Welches Ausmaß die Beeinflussung dieser Rollenmuster und Stereotypen einnimmt, soll in dieser Arbeit gekennzeichnet werden. 2. Unterschiede in der Sport- und Bewegungssozialisation Da es verschiedene Unterschiede in der Sport- und Bewegungssozialisation von Jungen und Mädchen gibt, sollen nun drei davon näher beleuchtet werden. 2.1 Bewegungsentwicklung Niemand kann bestreiten, dass die Bewegungsentwicklung schon aus Sicht der Biologie geschlechtertypisch differenziert verläuft. Jedoch ist das nicht der alleinige Grund für unterschiedliche Sportkarrieren bei Frauen und Männern. Nach Alfermann bedeutet das, dass ' ... Stereotype und normative Erwartungen an männliche und weibliche Personen gerichtet werden, die über die biologischen Geschlechterunterschiede hinaus gehen' (1995, S.3). Das heißt allerdings nicht, dass es eine beabsichtigte geschlechtertypische Erziehung der Kinder durch die Eltern stattfindet. Der Normalfall geht man von einer unbeabsichtigten Geschlechtertypisierung aus. Baur (1989) schreibt dazu, dass ein geschlechtstypisches Körpermanagement durch die Eltern-Kind-Interaktion angeregt und bekräftigt wird. Geschlechtstypische Verhaltensweisen werden eher behindert.
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Sport - Sportsoziologie, Note: gut, Universität Potsdam (Sportwissenschaft), Veranstaltung: Seminar Sportsoziologie: Sportengagment von Heranwachsenden, Sprache: Deutsch, Abstract: 1. geschlechtsspezifische Sozialisation 1.1 Vorbemerkungen Die Individuelle Entwicklung von Kindern wird in einem sehr hohen Maße durch die Zugehörigkeit zu einer Geschlechterkategorie bestimmt. Diese individuelle Entwicklung erfolgt nicht nur aufgrund von biologischen Unterschieden, sondern auch in sehr stark durch die sozialen Zuschreibungsmuster wie Rollenerwartungen und Stereotypen. Das bildet auch die Grundlage der sich dafür, das sich Sportkarrieren von Frauen und Männern unterscheiden. Welches Ausmaß die Beeinflussung dieser Rollenmuster und Stereotypen einnimmt, soll in dieser Arbeit gekennzeichnet werden. 2. Unterschiede in der Sport- und Bewegungssozialisation Da es verschiedene Unterschiede in der Sport- und Bewegungssozialisation von Jungen und Mädchen gibt, sollen nun drei davon näher beleuchtet werden. 2.1 Bewegungsentwicklung Niemand kann bestreiten, dass die Bewegungsentwicklung schon aus Sicht der Biologie geschlechtertypisch differenziert verläuft. Jedoch ist das nicht der alleinige Grund für unterschiedliche Sportkarrieren bei Frauen und Männern. Nach Alfermann bedeutet das, dass ' ... Stereotype und normative Erwartungen an männliche und weibliche Personen gerichtet werden, die über die biologischen Geschlechterunterschiede hinaus gehen' (1995, S.3). Das heißt allerdings nicht, dass es eine beabsichtigte geschlechtertypische Erziehung der Kinder durch die Eltern stattfindet. Der Normalfall geht man von einer unbeabsichtigten Geschlechtertypisierung aus. Baur (1989) schreibt dazu, dass ein geschlechtstypisches Körpermanagement durch die Eltern-Kind-Interaktion angeregt und bekräftigt wird. Geschlechtstypische Verhaltensweisen werden eher behindert.