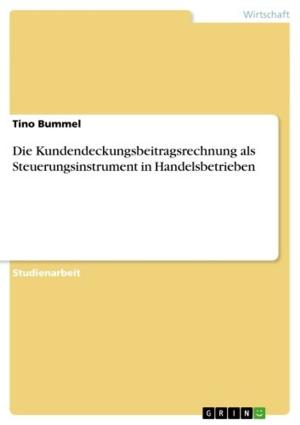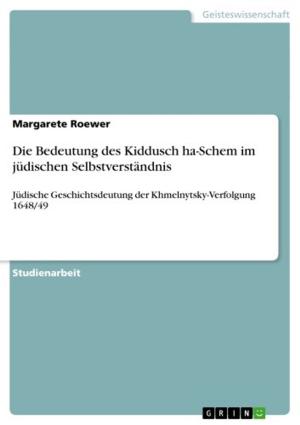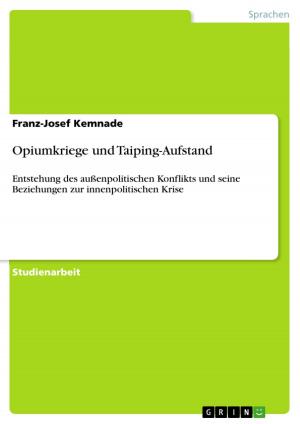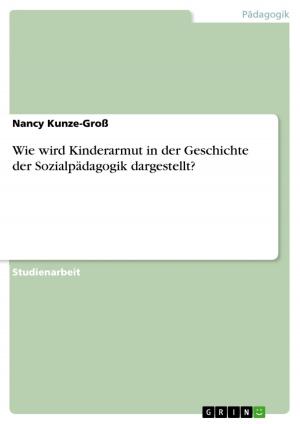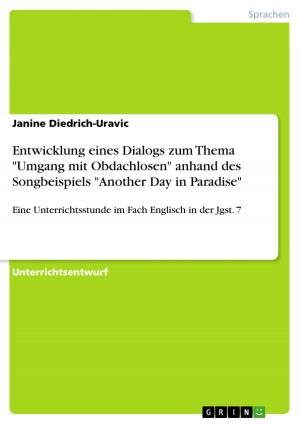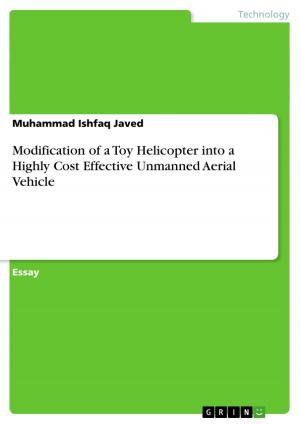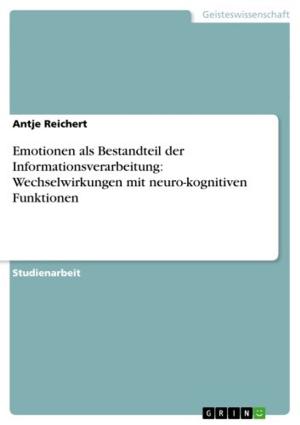Das Menschenbild als fundamentaler Baustein sonderpädagogischer Theorie und Praxis im historisch-gesellschaftlichen Wandlungsprozess
Nonfiction, Reference & Language, Education & Teaching, Special Education| Author: | Pia Weidenbach | ISBN: | 9783638560528 |
| Publisher: | GRIN Verlag | Publication: | October 24, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag | Language: | German |
| Author: | Pia Weidenbach |
| ISBN: | 9783638560528 |
| Publisher: | GRIN Verlag |
| Publication: | October 24, 2006 |
| Imprint: | GRIN Verlag |
| Language: | German |
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,0, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 100 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Werde ich nach meinem Studiengang gefragt und gebe zur Antwort, dass ich Lehramt an Sonderschulen studiere und später am liebsten mit Kindern mit geistiger Behinderung arbeiten würde, reagieren die Menschen sehr stark darauf. In den meisten Fällen sind sie erst einmal völlig überrascht und sagen mir, wie gut sie es finden, dass ich 'so etwas' mache. Danach bekomme ich meist die Sätze zu hören: 'Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen'; 'Hast du dir das gut überlegt?' oder 'Das könnte ich nicht'. Manchmal wird mir die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn mache Kindern mit geistiger Behinderung in Mathe oder Deutsch zu unterrichten. Die extremste Reaktion war die von einem mir fremden Mann, der mich im Zug nach meinem zukünftigen Beruf fragte. Auf meine Antwort reagierte er, indem er mir mehr als zwei Mal hintereinander sagte, dass ihn dies schockiere. Selbst beim Verlassen des Zuges, als das Thema gar nicht mehr im Raum stand, sagte er mir noch ein erneutes Mal, dass er geschockt sei. Zum einen verunsicherte es mich, weil ich diese Reaktion nicht verstehen konnte und versuchte mich auf einmal zu rechtfertigen, zum anderen wurde ich verärgert und auf eine gewisse Weise auch traurig, denn welche Sichtweise musste dieser Mann von Menschen mit geistiger Behinderung haben, dass er auf eine mir so unverständliche Weise reagierte? Ich fragte mich daraufhin aber auch selbst, welche menschenbildbezogene Sichtweise von Menschen mit Behinderung ich habe und welchen Einfluss diese auf mein Tun hat. Genau hier liegt der Ursprung zur Idee des Themas dieser Arbeit. Im ersten Teil meiner Arbeit möchte ich versuchen zu klären, was man unter einem Menschenbild versteht und verschiedene Menschenbilder im historischen Rückblick vorstellen. Hieran soll deutlich gemacht werden, welche fatalen Auswirkungen das Menschenbild auf die Behandlung von, in diesem Fall, Menschen mit geistiger Behinderung, haben kann. Die Geschichte der Erziehung und Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung war nämlich von Anfang an von einem Menschenbild geprägt, welches die so genannte geistige Behinderung gleichsetzte mit einer, alle Lebensbereiche betreffenden durchdringenden Abhängigkeit von Hilfe, einer völligen Überwachungs-, Kontroll- und Anleitungsbedürftigkeit. Den Menschen wurde damit Personalität, Persönlichkeit bzw. ein 'Selbstsein-dürfen' (Theunissen 2002, 48) in weitem Maße abgesprochen. Menschen mit geistiger Behinderung wurden als Mängel- oder Defizitwesen angesehen.
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 1,0, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 100 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Werde ich nach meinem Studiengang gefragt und gebe zur Antwort, dass ich Lehramt an Sonderschulen studiere und später am liebsten mit Kindern mit geistiger Behinderung arbeiten würde, reagieren die Menschen sehr stark darauf. In den meisten Fällen sind sie erst einmal völlig überrascht und sagen mir, wie gut sie es finden, dass ich 'so etwas' mache. Danach bekomme ich meist die Sätze zu hören: 'Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen'; 'Hast du dir das gut überlegt?' oder 'Das könnte ich nicht'. Manchmal wird mir die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn mache Kindern mit geistiger Behinderung in Mathe oder Deutsch zu unterrichten. Die extremste Reaktion war die von einem mir fremden Mann, der mich im Zug nach meinem zukünftigen Beruf fragte. Auf meine Antwort reagierte er, indem er mir mehr als zwei Mal hintereinander sagte, dass ihn dies schockiere. Selbst beim Verlassen des Zuges, als das Thema gar nicht mehr im Raum stand, sagte er mir noch ein erneutes Mal, dass er geschockt sei. Zum einen verunsicherte es mich, weil ich diese Reaktion nicht verstehen konnte und versuchte mich auf einmal zu rechtfertigen, zum anderen wurde ich verärgert und auf eine gewisse Weise auch traurig, denn welche Sichtweise musste dieser Mann von Menschen mit geistiger Behinderung haben, dass er auf eine mir so unverständliche Weise reagierte? Ich fragte mich daraufhin aber auch selbst, welche menschenbildbezogene Sichtweise von Menschen mit Behinderung ich habe und welchen Einfluss diese auf mein Tun hat. Genau hier liegt der Ursprung zur Idee des Themas dieser Arbeit. Im ersten Teil meiner Arbeit möchte ich versuchen zu klären, was man unter einem Menschenbild versteht und verschiedene Menschenbilder im historischen Rückblick vorstellen. Hieran soll deutlich gemacht werden, welche fatalen Auswirkungen das Menschenbild auf die Behandlung von, in diesem Fall, Menschen mit geistiger Behinderung, haben kann. Die Geschichte der Erziehung und Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung war nämlich von Anfang an von einem Menschenbild geprägt, welches die so genannte geistige Behinderung gleichsetzte mit einer, alle Lebensbereiche betreffenden durchdringenden Abhängigkeit von Hilfe, einer völligen Überwachungs-, Kontroll- und Anleitungsbedürftigkeit. Den Menschen wurde damit Personalität, Persönlichkeit bzw. ein 'Selbstsein-dürfen' (Theunissen 2002, 48) in weitem Maße abgesprochen. Menschen mit geistiger Behinderung wurden als Mängel- oder Defizitwesen angesehen.